
|
Die
anfänglich nur in geringen Maße anfallenden Werkstättenarbeiten wurden in
der Heizhauswerkstätte Caslau durchgeführt. Diese wurde Ende 1870
unter entsprechender Erweiterung nach Gross Wossek verlegt. Im Dezember 1871
wurde die Hilfswerkstätte Trautenau und im Jänner
1872 die Werkstätte Iglau, bei gleichzeitiger Reduktion der Werkstätte
Gross Wossek errichtet. 1872 benötigte
die ÖNWB bereits 95 Lokomotiven der Reihen IIIa, Va,b,c,d,e und VIII
zur Betriebsabwicklung, und man schritt daran eine definitive Hauptwerkstätte
in Wien in der Station Floridsdorf – Jedlesee (später Jedlesee benannt)
zu errichten.
|
Foto: Koloniestrasse 26, das ehemalige
Verwaltungsgebäude, später ein Wohnhaus. (Foto 2006)
Wurde im November 2009 abgerissen.
|
|
Am
1.6.1872 wurde die Strecke Wien Nordwestbahnhof
- Floridsdorf-Jedlesee - Jedlersdorf-Transit eröffnet, wodurch die gleismässige
Anbindung der neuen Hauptwerkstätte an das Streckennetz der ÖNWB ermöglicht
wurde. Das 45.000 m2
große Gelände der in Floridsdorf (Wien 21.) liegenden Hauptwerkstätte
Jedlesee erstreckte sich von km 5,4 bis km 6,1 der Strecke Wien - Deutschbrod und wurde von der Lokomotivgasse, der Koloniestrasse, der
heutigen 0' Briengasse und dem Nordwestbahn-Streckengleis begrenzt.
|
Die Grundeinlösungsverhandlungen
begannen bereits im Juli 1870 und nach
Planerstellung im Sommer 1871 wurde am 4.3.1872
mit der Errichtung der Hauptwerkstätte (HW) und dem Material-Magazin begonnen.
Der Bau unter der Leitung von Baumeister Karl Pollak schritt rasch voran und
bereits im Juni 1872 stand eine größere
Anzahl von Maschinen in Betrieb. Am 1.9.1872,
wurde die ÖNWB-Hauptwerkstätte, deren Baukosten
sich auf rund 432.000 Gulden beliefen, fertiggestellt.
Die Werkstätte, sie war für die gleichzeitige
Reparatur von 12 Lokomotiven und 60 Wagen ausgelegt worden, bestand aus zwei
gesonderten Bauten in Rechteckform.
|

Foto: Das Portierhaus, 2006 eine aufgelassene
Gartenhütte. Wurde Ende
2008 abgerissen.
|
|
Der nördliche Bau enthielt die
Lokomotivmontierung, die Dreherei, die Kesselschmiede, die Schmiede und
Holzbearbeitungsraume. Der südliche Bau beinhaltete
die Wagenmontierung, die Lackiererei und die Sattlerwerkstätte. Der
dazwischenliegende weite Hofraum wurde an der Koloniestraße vom
Verwaltungsgebäude mit Kanzleien und Wohnungen und dem Portierhaus, an der
gegenüberliegenden Seite beim Streckengleis vom Wasserturm, der sämtliche
Werkstättengebäude mit Wasser versorgte, und vom Holzdepot flankiert. Die
einzelnen Stände der beiden Werkstätten wurden durch je eine nicht
versenkte Schiebebühne verbunden. Im südseitigen Hof befand sich darüber
hinaus noch eine Dampfschiebebühne. An Hebezeugen standen von Beginn an
Laufkrane mit 1,5 t, 3 t und 4 t zur Verfügung. Der Antrieb der 50
Arbeitsmaschinen erfolgte durch ein Lokomobil mit 18 kW Leistung.
|
Das
zweistöckige Material-Magazin befand sich in der südöstlichen Ecke des
Geländes, unmittelbar daran anschließend stand das Bürogebäude mit
Wohnungen für den Magazinsdienst.
Erster
und jahrzehntelanger Vorstand der neuen Hauptwerkstätte war Oberinspektor
Gustav Stockhammer, dem anfänglich nur 89 Bedienstete zur Verfügung
standen. In den folgenden Jahren erhöhte sich der Personalstand jedoch ständig:
So waren 1898 520 und 1919 bereits 654 Beschäftigte
zu verzeichnen.
|
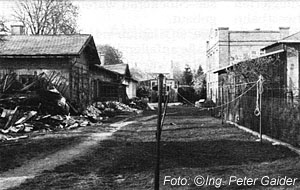
|
|
Foto: 1982,
Links das ebenerdige
Restaurationsgebäude, wenige Tage vor dem Abbruch. Rechts
der ehemalige Bürotrakt der Lokomotivmontierung.
|
|
1875
wurde nördlich des Werkstättengeländes die sogenannte
"Nordwestbahnkolonie" - Arbeiterwohnhäuser mit 165 Wohnungen, die
auch heute noch bestehen - und im folgenden Jahr in der Koloniestraße ein
Arbeitersaal mit einer kleinen Restauration errichtet.
|

|
Nach
zehnjährigem Bestand wurde 1882 die
Kesselschmiede neu gebaut. 1885 und 1896
wurde die Wagenmontierung und 1895 und 1897
die Lokomotivmontierung erweitert. Nach den letzten Baumaßnahmen, die
verbaute Fläche vergrößerte sich auf rund 17.000 m2,
hatte die Werkstätte 22 Lok- und 120 Wagenstände in durchwegs heizbaren Räumen
zur Verfügung.
Südlich der Wagenmontierung wurden zwei
neue Schiebebühnen errichtet und die Anzahl der Arbeitsmaschinen erhöhte
sich auf 77 Stück.
|
|
Foto: 1982,
Der ehemalige Bürotrakt der Lokomotivmontierung, 1982 noch inmitten von
Schrebergärten. Unmittelbar dahinter, am Bild durch die Bretterbude
verdeckt, schloss früher die Werkstätte mit der in der Mitte gelegene
Schiebebühne an.
|
|
Das Lokomobil wurde von einer neuen 29 kW starken,
einzylindrischen Ventilmaschine und einem Siederohrkessel mit 54 m2
Heizfläche und 9 bar Dampfdruck, dessen Abdampf zur Beheizung der
Lokomotivmontierung verwendet wurde, ersetzt. 1901
vermehrte man die Zahl der Lokstände abermals und baute eine zehnteilige
Lokomotiv-Brückenwaage.
|

|

|
|
Fotos:
Ehemalige
Einfahrt in die HW Jedlesee, unmittelbar westlich (strassenseitig) des
Aufnahmegebäudes Jedlesee. Links daneben das zweistöckige Büro- und
Wohngebäude des Materialmagazinsdienstes, dahinter der verbleibende Rest
des Materialmagazins. Foto: links 1982, rechts 2007
|
|
Südlich
an die Werkstätte anschließend befand sich von 1877
bis 1910 das Gelände der Imprägnierungsanstalt
John B. Blythe,
die imprägnierte Eichen- und Kieferschwellen an die ÖNWB lieferte.
Nachdem 1910 ein Feuer die Anstalt
vernichtete, wurde das Gelände von der Hauptwerkstätte übernommen.
|
Rückwirkend
mit 1.1.1908 wurde die k.k. priv. Österr.
Nordwestbahn verstaatlicht, und mit 15.10.1909
übernahmen die k.k. Staatsbahnen den Betrieb.
Zur
Bewältigung des erhöhten Reparatursaufkommens, bedingt durch den starken
Verkehr während des 1.Weltkrieges, wurde 1916
in Jedlersdorf/Strebersdorf etwa auf dem Gelände der heutigen
Wagenwerkstätte Jedlersdorf der HW Floridsdorf eine Hilfswerkstätte
der HW Jedlesee errichtet, die jedoch nach dem Krieg
wieder aufgelassen wurde. 1918 mussten
provisorische Gebäude für die Erweiterung der Schmiede und der Dreherei
gebaut werden.
|
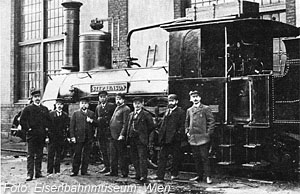
|
|
Foto: Lok Nr. 13 anlässlich einer
Hauptausbesserung im Jahre 1905 in der HW Jedlesee. Die 2B-n2
Personenzuglokomotive "Stephenson" wurde 1870 erbaut, erhielt von
der kkStB die Nummer 16.03 und landete später bei den Tschechoslowakischen
Staatsbahnen (Nr. 232.002)
|
|
Die
ersten Einschränkungen trafen die Werkstätte allerdings bereits wenige
Jahre später. 1922 wurde in Jedlesee die
Lokomotivreparatur aufgegeben und die Werkstätte in eine reine
Personenwagen-HW mit einer Kapazität von 550 Wagen umgestaltet. Der
Personalstand verringerte sich um über 200 auf rund 400 Beschäftigte.
|
|
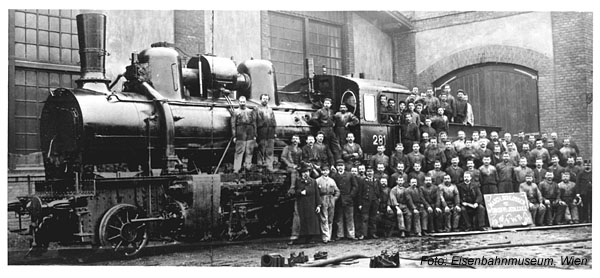
|
|
Foto:
Lok
Nr. 281 der Reihe XVIIa vor der Lokomotivmontierung der HW 1905. Die 1C-n2
Güterzuglok der ÖNWB wurde 1902 unter der Fabr.Nr. 1473 in der
Lokomotivfabrik Floridsdorf erbaut. Die kkStB ordnet die insgesamt 4
Lokomotiven der Reihe XVIIa als Reihe 360 ein und bezeichnete die 281 als
360.01. Von der DR erhielt sie die Nummer 54.201, von den ÖBB 254.201. Am
27.10.1953 wurde die Lokomotive aus dem Lokomotivstand ausgeschieden und
wurde Werkslok WL 913.501 der HW Simmering, ehe sie 1960 kassiert wurde.
|
Aus
Einsparungsgründen wurde mit 1.2.1924 die
Strecke Wien Nordwestbahnhof - Jedlersdorf für den Personenverkehr
gesperrt. Lediglich ein bescheidener Güterverkehr frequentierte von nun an
die Strecke über Jedlesee nach Wien. Der starke Verkehrsrückgang infolge
der Weltwirtschaftskrise brachte den 15 Hauptwerkstätten der Österreichischen
Bundesbahnen, davon allein sechs im Wiener Raum, einen akuten Beschäftigungsnotstand,
und so wurde schließlich im Jahre 1928 aus
Einsparungsgründen neben den Hauptwerkstätten Wien-West und Wien-Süd auch
die HW Jedlesee von den BBÖ aufgelassen.
Die letzten Wagenausbesserungen
wurden im Dezember 1927 durchgeführt und per 31.12.1927
wurde der Werkstättenbetrieb beendet. Die Mehrzahl der Bediensteten von
Jedlesee übersiedelte bereits 1927 in die damals noch selbstständige und
von der Lokomotivwerkstätte getrennte Wagewerkstätte Floridsdorf an der Brünner
Straße (später Hauptwerkstätte Floridsdorf) zur Güterwagenausbesserung.
Lediglich 14 Arbeiter waren Anfangs 1928 noch
damit beschäftigt die Werkzeugmaschinen zu demontieren und deren Übersiedlung
in andere Bundesbahnwerkstätten durchzuführen.
|

|
1929
pachtete die La. Pollitzer und Wertheim das Werkstättengelände auf einige
Jahre und verschrottete hier ausgemusterte Lokomotiven und Wagen. 1935
wurden die Gleise und die Werkstätten abgetragen.
Foto:
BBÖ 503.11 (Wr. Neustadt 3900/1896) früher SB 17c 402, kassiert 1932 in
Jedlesee 17.05.1932
|
|
Auf
dem großen freien Gelände wurden Schrebergärten angelegt, die auch 2007 noch existieren. Die Abtragung der
letzten Gleisstutzen mit den zugehörigen Weichen, Putzgruben und
Drehscheiben, dreier Schuppen, der Lokomotiv-Brückenwaage und der
Schlauchwerkstätte wurde schließlich mit Bescheid vom 5.3.1938
genehmigt. Damit verschwanden 66 Jahre nach Erbauung der Hauptwerkstätte-Jedlesee
fast alle Baulichkeiten.
|
|

|
|
Foto:
BBÖ 371.07 (Esslingen 232/1853) früher SB 33 918 KAPELLEN, kassiert 1929
|
Die
Werkstätte Jedlesee hat, so wie auch viele andere den jeweiligen
Bahngesellschaften gehörende Werkstätten, in bescheidenen Maße, vor allem
in der Anfangszeit der ÖNWB, auch Neubauten durchgeführt. So wurde z.B. 1873
der erste Dreiachser der .Nordwestbahn, ein Plateuwagen mit Rungen, Nr.
12.793, hier erbaut.
Heute
erinnern lediglich das Verwaltungsgebäude in der Koloniestraße 26, derzeit
(2007)
ein Wohnhaus, das Portierhaus, das Büro- und Wohngebäude des
Magazinsdienstes sowie der gemauerte ebenerdige Teil des Material-Magazins
und zwei je. ca. 50 m lange Gleisstutzen - die ehemalige Einfahrt in die HW an die Zeit, als in Floridsdorf neben den ehemaligen
Nordbahnwerkstätten (heutige TS Werkstätte Floridsdorf, vormals HW
Floridsdorf 1852
bis dato) und der von 1869 bis 1969
in Betrieb gestandenen Wiener Lokomotivfabrik von 1872 bis
1928
auch noch eine dritte große Eisenbahnwerkstätte, die Hauptwerkstätte
Jedlesee der k.k. priv. Österr. Nordwestbahn, bestand.
|
|
|
|
Die Arbeiterhäuser,
"Nordwestbahn - Colonie" genannt.
|
|
Da sich in den entlegenen Nachbarorten für
Beamte und Arbeiter nicht genug Wohnungen finden ließen wurden im Jahre 1873
nördlich der Werkstätten acht Arbeiterhäuser mit 80 Wohnungen
gebaut.
|

|
Die vom Baumeister Lambert Stummfohl errichteten
Wohnhäuser bestanden aus Zimmer und Küche samt Nebenräumen für
verheiratete und 24 Kabinetten für ledige Arbeiter.
Zu jeder Familienwohnung gehörte ein kleines Gärtchen.
Im Jahr 1874 wurde das Restaurationsgebäude
mit hübschem Gastgarten fertiggestellt.
Fotos und Text: Ernst
Sladek
Abgebildete Häuser
wurden in März 2008 abgerissen
|
|
|

|

|
|
|
|
Literaturhinweise:
|